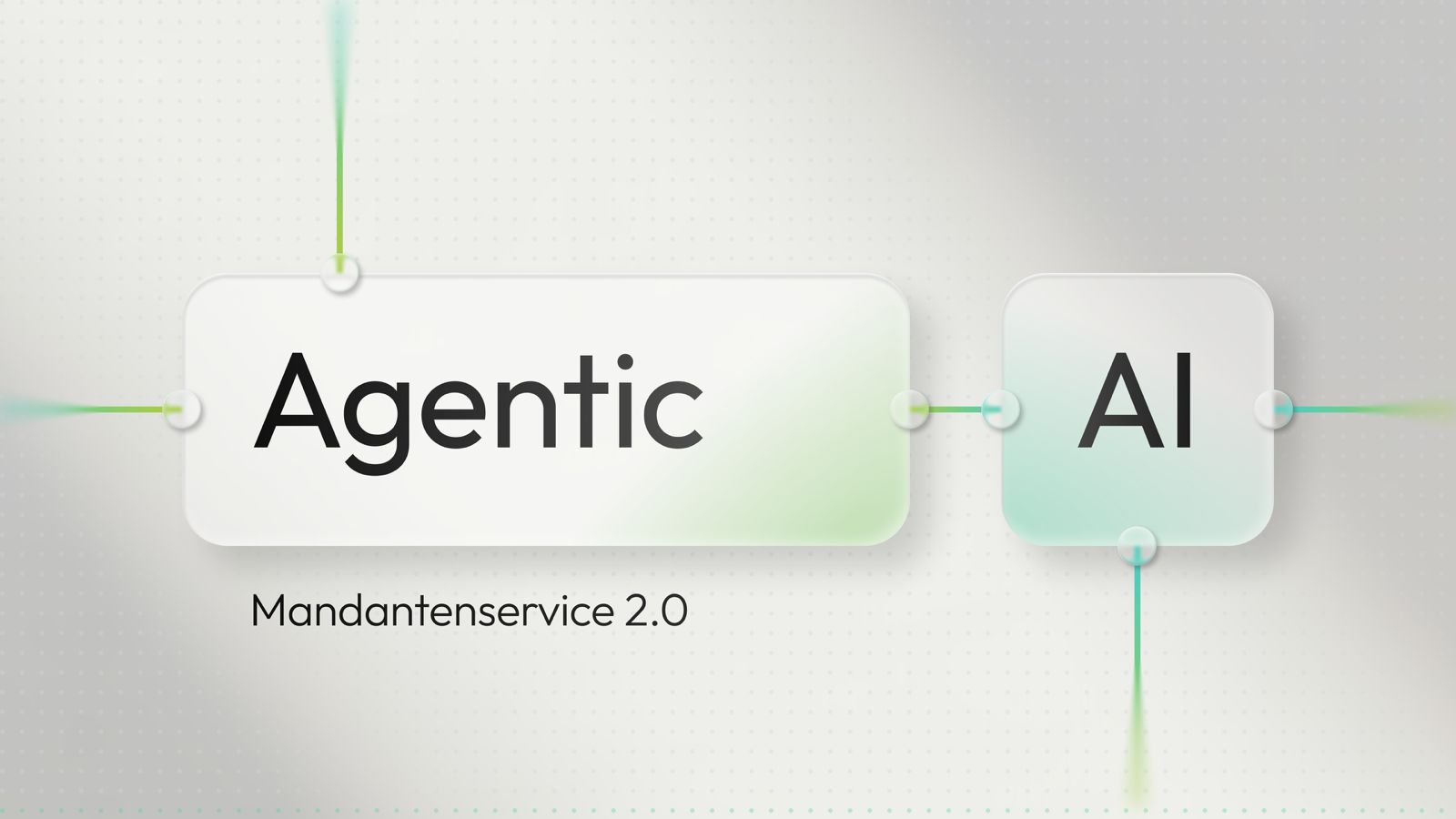Künstliche Intelligenz (KI) dringt immer tiefer in den Alltag und die Arbeitswelt ein. Welche Bedeutung sie im «Lean Quality Management» – einer Produktionsphilosophie, die Verschwendung reduziert, Produktivität steigert und Fehler eliminiert – hat, erläuterte Benjamin van Giffen in seiner Antrittsvorlesung an der Universität Liechtenstein. Seit September 2024 leitet van Giffen dort den Lehrstuhl für Information Systems und digitale Innovation.
Die Kernproblematik fasste er so zusammen: «Für einen Teamleiter in der Fertigung ist es leichter, ein unlösbares Problem zu akzeptieren, als eine Lösung, die er nicht versteht.» Ein unlösbares Problem lässt sich durch Alternativen umgehen. Übernimmt jedoch KI die Problemlösung, verliert der Verantwortliche die Kontrolle. Deshalb müsse die Einführung von KI mit der Unternehmenskultur harmonieren.
Die Qualität der Daten ist entscheidend
Wie das in der Praxis gelingt, zeigte van Giffen anhand der Elektronikwerkstatt von Siemens in Hamburg. Dort hat man vor Jahrzehnten hohe Qualitätsstandards und eine geringe Fehlerquote etabliert und stetig verbessert. Ein Beispiel: Beim Bestücken von Leiterplatten für Maschinensteuerungen mit elektronischen Bauteilen ist höchste Präzision gefragt. Da menschliche Kontrolle allein nicht ausreicht, müssen die Bauteile einzeln durch eine Röntgenmaschine geprüft wer-den – ein zeitaufwendiger Prozess. Siemens entwickelte daher eine KI-Anwendung, die auf Basis aller während der Produktion erfasster Daten vorhersagt, ob ein Produkt fehlerfrei ist. Produkte mit hoher Fehlerwahrscheinlichkeit werden gar nicht erst getestet, sondern aussortiert.
Damit die KI solche Entscheidungen zuverlässig trifft, ist laut van Giffen eine hohe Datenqualität entscheidend. «Es beginnt damit, das Geschäftsproblem zu verstehen und klar zu definieren, das ich mit der KI lösen will«, betonte er. KI einfach einzusetzen, ohne das Ziel zu kennen, bringe keine Fortschritte in der Prozessoptimierung. Gerade für ein Land wie Liechtenstein mit seiner Wirtschaftsstruktur sei die Integration von KI im «Lean Quality Management» von höchster Relevanz, dies wirft jedoch zahlreiche Fragen auf.
Die Aufteilung von Aufgaben zwischen KI und Mensch werde in vielen Berufsfeldern eine Rolle spielen und müsse mit fortschreitender Entwicklung immer wieder von Neuem thematisiert werden. Daher sei die KI-Integration in Arbeitsprozesse auch niemals komplett abgeschlossen, so van Giffen.
Nachgefragt bei Benjamin van Giffen
«KI-Adaption relevantes Thema für Liechtenstein»
Herr van Giffen. Sie haben in Ihrer Antrittsvorlesung das Thema KI-Adaption im Bereich «Lean Quality Management» gesprochen. Warum haben Sie sich genau diese Thematik ausgesucht?
Benjamin van Giffen: Weil die Einbringung dieser Technologie in die hoch qualifizierten Fertigungsbetriebe hier in Liechtenstein ein sehr relevantes Thema ist, sowohl für Banken und Finanzdienstleister wie auch für produzierende Unternehmen. In all diese Bereichen ist Qualität von höchster Bedeutung.
Was gilt es bei der Integration von KI in diesen Bereich besonders zu beachten?
Erstmal müssen die technischen Voraussetzungen geklärt werden. Ich muss ein relevantes Problem lösen und dafür die zur Verfügung stehenden Daten kennen und verstehen. Danach gilt es, den richtigen Algorithmus auszuwählen und sicherstellen, dass dieser über die notwendige Qualität verfügt. Und schliesslich muss die KI auch so eingesetzt werden, wie es der Unternehmenskultur entspricht. Dabei gibt es drei Fragen, die man unbedingt beantworten sollte.
Welche wären das?
Das erste ist, Klarheit darüber zu schaffen, welche Entscheidung, Analyse und Massnahme eine KI, welche ein Mensch und welche beide gemeinsam machen sollten. Zweitens muss geklärt werden, wo Transparenz unabdingbar ist und wo ein gewisses Mass an Intransparenz zugelassen werden kann. Und der dritte Punkt ist der Umgang mit der Tatsache, dass in der bestehenden Beschäftigung ein definiertes Qualitätsniveau und bei der KI ein prädikatives Qualitätsniveau herrscht, der sich erst aus dem Entwicklungsprozess ergibt.
In welchen Bereichen ist der Mensch aus Ihrer Sicht der KI überlegen? Welche Aufgaben sollten nicht an die Technologie delegiert werden?
Alle Aufgaben, in denen Qualitäten gefragt sind, die uns als Menschen ausmachen. Ich denke hier vor allem an zwischenmenschliche Themen, wo Empathie und Einfühlungsvermögen, aber auch Kreativität gefragt sind, und es darum geht, Menschen zusammenzubringen und zu inspirieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir in der Ausbildung hier an der Universität Liechtenstein mündige und reflektierte Studierende hervorbringen, die sich kritisch mit der Technologie auseinandersetzen und Führungskompetenzen entwickeln können.
Autor: Tobias Soraperra, Wirtschaftregional